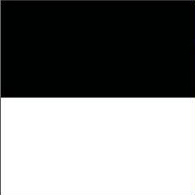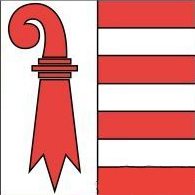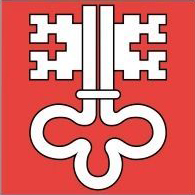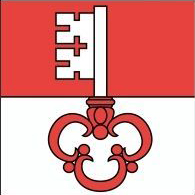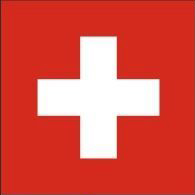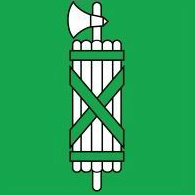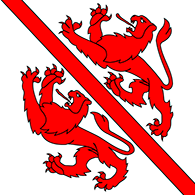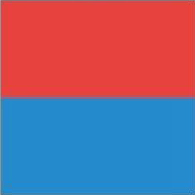«Das System braucht Zeit»
Herisau. Im Gespräch mit appenzell24.ch spricht Hans-Rudolf Merz über seine Rolle im Bundesrat und seine Tätigkeit ab Januar 2008.
Herr Merz, am 10. November feierten Sie Ihren 64. Geburtstag. Hatten Sie irgendwelche besonderen Wünsche für diesen Tag?
Hans-Rudolf Merz: Früher fiel mein Geburtstag meistens in die Militärzeit. Die Appenzeller Truppen führten ihren WK jeweils im Herbst durch. Daher habe ich keine spezielle Geburtstagstradition entwickelt, also auch keine Wünsche.
Sie waren Ende Oktober auf Einladung der FDP Herisau und der FDP Ausserrhoden zu Gast in Herisau. Stellte der Anlass in Ihrem Heimatort etwas Besonderes für Sie dar?
Ich bin nun drei Jahre im Amt und seither nie in Herisau aufgetreten. Aber ich habe den Kontakt mit dem Herisauer Volk nie verloren. Daher war auch der Anlass ein Heimspiel.
Wie viel Zeit bleibt Ihnen überhaupt noch, um solche privaten Kontakte zu pflegen?
Nicht wirklich viel. Häufig kommt es vor, dass ich auch am Wochenende noch Unterlagen für die Sitzungen der nächsten Woche nach Hause nehme. Wenn ich am Samstag also noch Verpflichtungen habe – was nicht selten ist – und den Sonntagnachmittag dem Aktenstudium widme, dann bleibt nur noch der Sonntagmorgen. Diesen halben Tag will ich dann aber ganz für mich haben.
Die Akten dürften Geschäfte beinhalten, welche die ganze Schweiz betreffen. Wie sehr interessiert sich der Herisauer Hans-Ruedi Merz noch für politische Geschehnisse in seinem Kanton, beispielsweise der Entscheid des Bundesgerichts im Zusammenhang mit der Degression?
Hier bin ich natürlich in zweierlei Hinsicht betroffen. Einerseits als Finanzminister und andererseits als Kantonseinwohner, der sich als Privatperson mit der geplanten Steuergesetzrevision auseinander gesetzt hatte. Allerdings muss ich hierzu klar sagen, dass ich davon nicht betroffen gewesen wäre. Man weiss ja, was ein Bundesrat jährlich verdient. Demnach wäre ich nicht unter die degressive Einkommensbesteuerung gefallen.
Und wie beurteilen Sie als Finanzminister das Urteil?
Den Willen eines Kantons, im Steuerwettbewerb mitzumachen, beurteile ich grundsätzlich als positiv. Aber auf der anderen Seite gibt es Werte wie Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte. Sie sind die Grundwerte eines Staates. Ich habe mit Genugtuung festgestellt, dass das Bundesgericht eben gerade die rechtsstaatlichen Aspekte stark gewichtet. Das gibt mir Vertrauen in die Institutionen unseres Staates.
Aber die Regierung wollte mit dieser Steuerpolitik ein Zeichen setzen. Es ist doch eigentlich peinlich, wenn ein Bundesgericht korrigieren muss, was eine Regierung monatelange erarbeitet hat.
Das empfinde ich nicht so, denn das Bundesgericht hat die mangelnde Einheit der Materie gerügt. In diesem Sinne ist das Urteil nicht ein materielles Steuerurteil, sondern ein demokratiepolitisches Urteil. Das Bundesgericht musste übrigens auch schon bei anderen Kantonen eingreifen. Das ist das Spiel unserer Institutionen, das ich wie gesagt als sehr positiv beurteile.
Die SP lancierte eine Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb». Der gegenüber stehen die steuerlichen Brandherde wie beispielsweise Obwalden und Ausserrhoden. Wie beurteilen Sie dieses Spannungsfeld?
Man darf das nicht als Brandherd anschauen, sondern im positiven Sinne als eine Art Labor, als Laborversuche, die dem ganzen Land dienen. Um das zu verstehen, muss man sich zuerst klar vor Augen führen, was Steuerwettbewerb überhaupt ist.
Erklären Sie es uns.
Das Volk, das Parlament und die Regierung eines jeden Kantons beschliessen zusammen sowohl über die Einnahmen wie auch über die Ausgaben. Das ist in unserem Finanzföderalismus ein ganz wichtiges Element. Der Föderalismus in den Oststaaten hatte einen sehr schlechten Ruf. Warum? Er war dort nur ein Vorwand von Zentralregierungen, die Regionen an sich heran zu binden. Aber finanzielle Mittel haben diese Regionen keine erhalten. Bei uns ist das anders – und zwar ausgeprägt anders. Damit haben unsere Kantone bei den Ausgaben und auch bei den Einnahmen die entsprechenden Möglichkeiten. Und es gehört mit zum Wettbewerb, dass man versucht, für sich selber die bestmögliche Platzierung zu finden. Neben attraktiven Steuern gehören dazu auch gute Infrastrukturen. Genau das machen die Kantone.
Und wie läuft das mit den «Laborversuchen»?
Ein Beispiel: Der Kanton Basel-Land hat beispielsweise bei der Wohneigentumsbesteuerung einen eigenen Weg beschritten. Wenn sich ein solch neuer Weg bewährt, wird er von anderen Kantonen eingeschlagen und zuletzt auch beim Bund übernommen. Wenn er sich nicht bewährt, kann er auf Kantonsebene leicht wieder abgebrochen werden. Im Zusammenhang mit dem Steuergesetz ist für mich aber wichtig zu wissen, dass trotz der degressiven Besteuerung in einzelnen Kantonen die absoluten Beträge am Steuereinkommen nicht abnehmen. Es ist also nicht so, dass die Reichen weniger zahlen.
Viele begrüssen solche Methoden, weil sie behaupten, dass der Bund ja sowieso nicht mit den Mitteln umgehen kann. Sie waren einst in der Wirtschaft und nun sind Sie Teil dieses «verschwenderischen Apparates».
Wenn Sie durch die Schweiz reisen, werden Sie feststellen, dass wir alles haben, was es zum Leben braucht. Wir haben eine ausgezeichnete Infrastruktur. Es kann also niemand sagen, dass unser Staat nicht funktioniert, dass Aufgaben, welche die Kantone zu erfüllen haben, nicht wahrgenommen werden. Es darf nicht passieren, dass die Kantone aushungern, bis sie nicht mehr in der Lage sind, ihre Aufgaben zu erfüllen. Deshalb gehört zum Finanzföderalismus noch ein weiteres Element dazu, nämlich der Finanzausgleich. Auch das funktioniert. Die Geberkantone werden immer darauf achten, dass die Nehmerkantone nicht über die Stränge hauen.
Sie mussten anfänglich auch Kritik einstecken. Nun glänzen Sie mit pechschwarzen Zahlen. Das muss eine Genugtuung für einen Finanzminister sein.
Es ist am Anfang sehr schwer für mich gewesen, die Entlastungsprogramme durch zu bringen. Wenn Sie Opfer verlangen, müssen Sie symmetrisch vorgehen. Man darf niemanden ausnehmen. Das war das Schwerste. Wir haben es aber geschafft, die Ausgaben um fünf Milliarden herunter zu bringen. Nun müssen wir aufpassen, dass nicht wieder der alte «Schlendrian» einsetzt. Es gibt viele ausserordentliche Ausgaben, die wir finanzieren müssen. Aber sicher freut mich die Entwicklung. Letztlich ist das Kerndossier des Finanzdepartements die Staatsrechnung.
Gab es nie Unsicherheiten auf dem Weg in die schwarzen Zahlen?
Eigentlich nicht, nein. Wichtig ist, dass man den Weg sucht und definiert, dass man weiss, wohin man will. Für mich war klar, dass ich bei einer Wahl in den Bundesrat mithelfen will, die Finanzen wieder ins Lot zu bringen. Das war von Beginn an mein Credo. Wenn man diese allgemeine Richtung einmal hat, gibt es sicherlich auch Rückschläge und Momente, in denen man denkt: «Oha, jetzt musst du eine Ehrenrunde einlegen». Aber in der Politik gilt es das zu akzeptieren. Der Feind des Guten ist das Bessere. Und manchmal muss man dann so lange ringen, bis man dieses Bessere erreicht.
Eigentlich kommen die Entlastungsprogramme doch viel zu spät. Kam Merz zu spät in den Bundesrat?
Das ist schwer zu beurteilen. Wenn das Problembewusstsein nicht vorhanden ist, passiert kaum etwas. Und alleine können Sie in diesem Land sowieso nichts bewegen. Sie müssen von Beginn an die Gewissheit haben, dass eine Mehrheit der politischen Kräfte ebenso denkt wie Sie, oder zumindest bereit ist, Ihnen zu folgen. Diese Bereitschaft kam erst nach gewissen Abstürzen in den 90er Jahren. Jetzt, wo es uns wieder etwas besser geht, werden aber von allen Seiten Begehrlichkeiten kommen. Manchmal denke ich, dass das, was nun auf mich zukommt, noch schwerer ist als der Weg dorthin. Jetzt muss ich das verteidigen, was wir aufgebaut haben. Stimmen werden laut werden, die sagen: «Jetzt haben wir jahrlang geschwiegen und die Kürzungen in Kauf genommen; nun wollen wir dafür die Rechnung präsentieren».
Sie sagen, dass man ohne Mehrheiten nichts bewegen kann. FDP-Präsident Fulvio Pelli sagte in einem Interview mit dem «Bund», dass es ihn irritiere, dass der Bundesrat aus sieben Einzelkämpfern besteht und keine Mannschaft bilde. Fühlen Sie sich tatsächlich als Einzelkämpfer?
Nein, überhaupt nicht. Was ich dazu bestätigend sagen kann ist: Sieben Departements haben sieben Kulturen. Und die Aufträge der einzelnen Bundesräte sind durchaus aufs eigene Departement fokussiert. Es gibt im Übrigen auch sieben Verordnungen über die Führung der Departements, in welchen die Aufgaben und Pflichten aufgeführt sind. Und in diesem Bereich ist man sicherlich manchmal ein Einzelkämpfer. Aber sobald es um die Entscheidungen in den Bundesratssitzungen geht, legt man diese Einzelkämpferrolle ab. Dann geht es um das Wohl des Landes. Wäre das nicht der Fall, würden wir keine Mehrheiten finden.
Wenn die Medien vom Bundesrat schreiben, dann häufig im Zusammenhang mit allfälligen internen Querelen. Stört Sie das?
Es sind ja nicht alle Medien gleich. Unsere Medienlandschaft ist sehr fragil. Man muss die Verlagshäuser, Chefredaktoren und Medienschaffenden einfach genau analysieren. Es gibt solche, die über den Bundesrat schreiben, als wären sie jeweils bei den Sitzungen dabei. Aber ich habe noch nie einen von denen bei uns gesehen. Ich wundere mich dann nur jeweils, was man anschliessend liest.
Wie steht es denn nun aber um die Stimmung im Bundesrat?
Sehen Sie, vor der Sitzung werden auf schriftlichem Wege Anträge gemacht. Und alles, was ohne Diskussion vor der Sitzung bereits bereinigt werden kann, wird abgehakt. Folglich bleiben nur jene Punkte, wo es unterschiedliche Meinungen gibt, welche diskutiert werden müssen. Dadurch kann der Eindruck entstehen, wir hätten nur Querelen. Ich war während vielen Jahren in mehreren Verwaltungsräten. Und ich kann Ihnen sagen, im Bundesrat geht es nicht wesentlich anders zu und her als in einem Verwaltungsrat. Man ringt nach Lösungen und ist sich nicht immer einig. Manchmal diskutiert man so lange, bis man auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Wenn man den nicht findet, wird abgestimmt.
Sie wurden vor Ihrer Wahl in den Bundesrat als Hoffnungsträger für die KMU betitelt. Mit Recht?
Ich glaube schon. Im KMU-Bereich ist einiges ins Rollen gekommen. Ich denke jetzt beispielsweise an die Unternehmenssteuerreform, aber auch an die Mehrwertsteuer, die wir auf die Bedürfnisse der KMU auslegen. Wir haben bei allen möglichen Geschäften immer wieder die Gesichtspunkte der KMU berücksichtigt. Ich denke, wir sind auf gutem Wege, die KMU weiter zu unterstützen. Jedenfalls habe ich von Seiten der KMU noch nichts anderes gehört.
Für gewisse Kreise waren Sie anfänglich aber auch eine Art Lichtgestalt, welche die Hoffnungen nicht erfüllte.
Ist das so gewesen?
Als Medienkonsument hat man in einer gewissen Phase den Eindruck erhalten, ja.
Als eine Lichtgestalt habe ich mich nie dargestellt. Ich bin immer mit beiden Füssen auf dem Boden geblieben, und ich glaube, dass ich jene Versprechen die ich abgegeben habe, auch gehalten habe. Sie können als Finanzminister sehr viel bewegen, aber Sie können nie ein Dossier alleine über die Runde bringen. Sie brauchen Koalitionen. Das ist mit ein Grund, weshalb man mich in vielen staatspolitischen Fragen weniger wahrnimmt als meine Kollegen.
Können Sie das näher erläutern?
Ich habe eine klare Meinung in Bezug auf die Zukunft und die Qualität unseres Landes. Ich habe eine Vision, wie das weitergehen soll, aber ich bin vorsichtiger als andere mit meinen Äusserungen.
Wegen der erwähnten Koalitionen?
Ja. Nehmen Sie zum Beispiel das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Der Vorsteher kann sich auf sein Departement konzentrieren, aber es ist legitim, dass er staatspolitisch auch zu anderen Themen Stellung bezieht. Allenfalls wird das sogar von ihm erwartet. Wenn ich jedoch beginne, in diesen Bereichen Kritik zu äussern, wird man mir in meinen Kerndossiers womöglich schnell die Gefolgschaft verweigern. Von daher bin ich auf diese Koalitionen angewiesen und muss vieles von meiner Tätigkeit sehr bewusst in die Öffentlichkeit hinaus tragen, um nicht noch zusätzlich polarisieren. Ich muss auf das Resultat achten. Aber dann muss man mich auch über das Resultat messen.
Unternehmer Peter Spuhler sagte in einem Interview, dass er nicht Bundesrat werden will, weil er dadurch weniger bewirken könnte. Stimmen Sie dem zu?
Ich kann seine Aussage nachvollziehen. Der Meinungsbildungsprozess in der Schweiz ist sehr langsam und sehr zähflüssig. Das ist ein Nachteil für all jene, die auf rasche Entscheidungen angewiesen sind. Und gerade in der Wirtschaft hat es natürlich sehr viele solche Personen. Dieser Umstand ärgert mich manchmal auch. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass die Qualität der Entscheidungsfindung auf diese Art sehr gut ist. Das System mit den beiden Räten braucht seine Zeit, aber die Qualität wird besser und folglich erreicht man eine höhere Abstützung in der Bevölkerung. Der Gradmesser dafür sind die Volksabstimmungen.
Am Anlass in Herisau verglich Nationalrätin Marianne Kleiner die FDP mit einer unterbewerteten Aktie. Stimmt der Vergleich?
Ja. Wir litten unter dem Umstand, dass auf der linken und auf der rechten Seite bewusst polarisiert wurde. Alle wissen: Sie können so lange polarisieren, wie es auf der anderen Seite einen Gegenpol gibt. Unsere Partei hat das nicht gemacht. Sie ging immer mit Augenmass an die Fragen heran und ist sicher weniger plakativ. Wir suchen nach Möglichkeiten, nach Lösungen, und das wird nicht immer gut honoriert. Ich habe das teilweise auch schmerzhaft erlebt, wenn eine Vorlage der FDP von links nach rechts durchgereicht wurde, bis man sich schliesslich wieder auf der anfänglichen Lösung der FDP einpendelte. Mir ist klar, dass sich eine Partei auch verkaufen muss. Und ich glaube, wir sind auf gutem Wege. Momentan definiert die Partei ihr Parteiprogramm neu. Anschliessend kann man den Wert der Aktie FDP neu beurteilen.
2007 ist ein Wahljahr. Inwiefern können, sollen oder müssen Sie als Bundesrat für Ihre Partei Einfluss nehmen.
Das ist eine Frage des Augenmasses. Alle Bundesräte werden mitwirken. Aber es darf nicht passieren, dass die Exekutivarbeit darunter leidet. Ich will ein Land, das wohlhabend, sicher, fortschrittlich, vielfältig und solidarisch ist. Da ist mein weltanschauliches Credo. Und dieses Credo soll das Volk kennen. Die Menschen sollen wissen, mit welchen Werten dieser Bundesrat Merz an seine Aufgaben herantritt. Darauf haben sie ein Anrecht. Es sind bürgerliche Weltanschauungen, die ich habe, und ich lass mich auch an diesen messen. Insofern glaube ich, dass jeder Bundesrat im Wahlkampf eine Rolle spielen wird.
Welches Amt wird Hans-Rudolf Merz im Januar 2008 innehaben?
Vorsteher des Finanzdepartements.